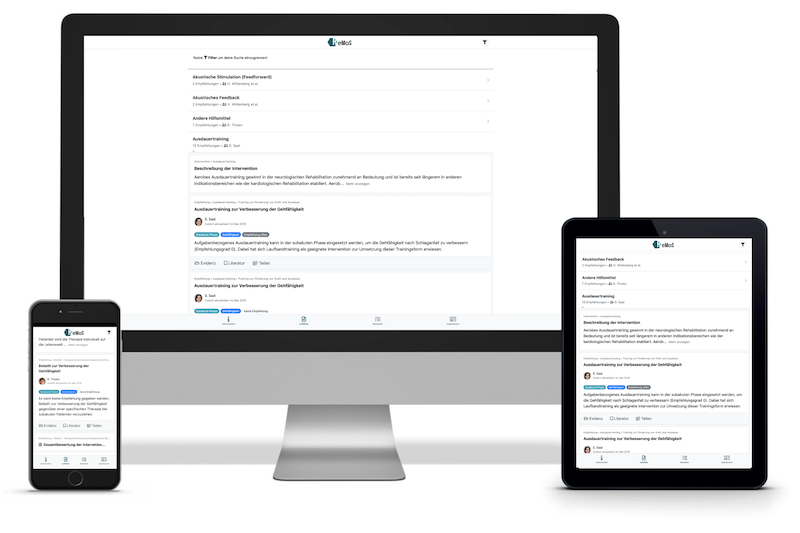
Die S2e-Leitlinie zur Rehabilitation der Mobilität nach Schlaganfall (ReMoS) beschäftigt sich mit folgender Leitfrage:
Welche Rehabilitationsmaßnahmen können empfohlen werden bei Patienten mit einem Schlaganfall oder einer Hemiparese nach Schlaganfall zu einer Verbesserung der
Eine Störung der Mobilität ist eine der häufigsten Folgen eines Schlaganfalls. Circa 260 000 Personen erleiden pro Jahr in Deutschland einen Schlaganfall (Daten für das Jahr 2008 in Heuschmann et al., 2010). Bei ungefähr 80% der Patienten findet sich ein sensomotorisches Defizit einer Seite (Rathore et al., 2002;Warlow et al., 2008), bei ca. 2/3 der Patienten ist zumindest initial die Mobilität gestört (Jorgensen 1995; Shaughnessy 2005). Für fast alle Patienten mit einer solchen Störung ist das Wiedererlernen des Gehens ein Hauptziel für die Rehabilitation (Bohannon et al. 1991).
Das genaue Schädigungsmuster wird dabei entscheidend von dem Ort und der Größe der Läsion beeinflusst. Klinisch bedeutsam ist zudem die Dauer der Paresen und der Funktionsstörungen. Wenn ein Gehen mit Hilfe nicht möglich geworden ist, so ist die Prognose für das Erlernen des selbstständigen Gehens leider schlecht (Kwakkel et al., 2006; Kwakkel&Kollen, 2013).
Die klinische Erfahrung hat gezeigt, dass therapeutische Interventionen nicht zu allen Zeitpunkten nach einem Schlaganfall gleich wirksam sind. Um die differentielle Wirksamkeit der Interventionen besser zu erfassen, wurden ihre Wirksamkeit in dieser Leitlinie jeweils im akuten, subakuten oder chronischen Stadium nach Schlaganfall erfasst. Für die Zwecke der nachfolgenden Leitlinie wurden die Zeitpunkte 3 Wochen bzw. 6 Monate als Grenzen zwischen den Behandlungsphasen akut – subakut – chronisch definiert.
Da in der Leitlinie keine Einschränkung der Form der rehabilitativen Interventionen zur Verbesserung des Stehens und Gehens gemacht wurde, war es auch auf Grund des Umfangs der gefunden Studien notwendig, die Zielkriterien auf funktionell relevante Parameter zu beschränken, Die Auswahl und Einstufung der Zielparameter erfolgte zunächst in einer ausführlichen Zwischenanalyse von 204 Referenzen (Publikationszeitraum April 2004 – Oktober 2006). Die Einstufung der Zielparameter wurde im Konsens der Leitliniengruppe auf die folgenden klinisch relevanten Punkte beschränkt:
Aus dieser Klassifizierung ergibt sich dann auch die Gliederung der Leitlinie nach Zielkriterien.
Zielgruppe waren Patientinnen und Patienten nach Schlaganfall, deren Mobilität gestört ist.
Stationäre, rehabilitative, und ambulante Versorgung (Krankenhäuser, Rehakliniken, ärztl. und therapeutische Praxen)
Neurorehabilitativ tätige Ärzte, Therapeuten (Physiotherapie, Ergotherapie, Sporttherapie)
|
Subakute Phase |
|
|
A (soll) |
|
|
B (sollte) |
• Intensives Gehtraining, falls verfügbar und realisierbar unter Einschluss des Gangtrainers |
|
0 (kann) |
• Intensives Gehtraining unter Einschlussdes Laufbands oder des Lokomaten • Zyklische Mehrkanalstimulation zur Erzeugung gehähnlicher Beinbewegungen des paretischen Beines im Liegen • Zusätzliche Elektroakupunktur • Für Patienten mit Neglect: Spezifisches Neglect-Training |
|
-B (sollte nicht) |
|
|
Chronische Phase |
|
|
Keine Einträge |
|
Subakute Phase |
|
|
A (soll) |
|
|
B (sollte) |
• Intensives Gehtraining: konventionell oder unter Einschluss des Laufbands (möglichst progressiv) |
|
0 (kann) |
• Aufgabenbezogenes Training mit Bewegungsvorstellung und • Nutzung von Gehhilfen • Kombinationstherapie aus Gangtrainer mit funktioneller Elektrostimulation • Nadelakupunktur inklusive Elektroakupunktur während intensiver Rehabilitation |
|
-B (sollte nicht) |
|
|
Chronische Phase |
|
|
A (soll) |
|
|
B (sollte) |
• Für Patienten mit spastischer Equinovarus-Deformität: Injektion von Botulinumtoxin zur Reduktion des Hilfsmittelgebrauchs |
|
0 (kann) |
• Unterstützung eines Laufbandtrainings mit VR |
|
-B (sollte nicht) |
• Für Patienten mit spastischer Equinovarus-Deformität: Thermokoagulation des N. tibialis |
|
Subakute Phase |
|
|
A (soll) |
• Aufgabenbezogenes progressives Ausdauertraining (in der Umsetzung Laufband oder progressives Zirkeltraining) |
|
B (sollte) |
• Intensives Gehtraining ohne Laufband oder • Intensives Gehtraining unter Einschluss eines Laufbands oder • Intensives supervidiertes Heimübungsprogramm (Kräftigung, Ausdauer, Balance) mit Progression • Gangtraining mit Stimulation von Flexorreflex-Afferenzen |
|
0 (kann) |
• Intensives progressives aufgabenbezogenes Training • Aufgabenbezogenes Training mit Bewegungsvorstellung • Gehtraining mit Gehtrainer oder Lokomat, wenn Gerät vorhanden • Kraft-Ausdauertraining • Isokinetisches Krafttraining • Kraft-/Ausdauertraining • Gehtraining mit akustischer Stimulation • Akustisches Feedback beim Gehen • Feedback/Reinforcement (tägliche Zeitmessung beim Gehen mit verstärkendem Feedback) • Kombinationstherapie aus Gangtrainer mit funktioneller Elektrostimulation • Elektroakupunktur • Sprunggelenksorthese • Frühzeitiger orthopädischer Schuh • Bei schwerer Armparese: Armschlinge |
|
-B (sollte nicht) |
|
|
Chronische Phase |
|
|
A (soll) |
|
|
B (sollte) |
• Orthese mit Elektrostimulation des N. peronäus (mittelbarer Effekt) |
|
0 (kann) |
• Intensives progressives aufgabenbezogenes Training • Aufgabenbezogenes Ausdauertraining, z.B. progressives aerobes Laufbandtraining • Kombination aus Laufbandtraining und variablem Gehtraining auf dem Boden • Gehtraining mit Gehtrainer, wenn Gerät vorhanden • Zusätzliches Training von Rückwärtsgehen • Aufgabenbezogenes Krafttraining • Zusätzlicher Balancetrainer • Kraftfeedbacktraining • Zusätzliches VR-basiertes Training • Zusätzliches Dual-Task-Training • Bewegungsbeobachtung • TENS am Sehnenübergang des spastischen M. gastrocnemius • TENS an Akupunkturpunkten vor einem aufgabenorientierten Training • Sprunggelenksorthese • Orthese mit Elektrostimulation des N. peronäus (unmittelbarer Effekt) • Zehenspreizer mit/ohne Schuh • repetitive Magnetstimulation in Kombination mit aufgabenorientiertem Training |
|
-B (sollte nicht) |
• Für Patienten mit spastischer Equinovarus-Deformität: Thermokoagulation des N. tibialis |
|
Subakute Phase |
|
|
A (soll) |
• Aufgabenbezogenes progressives Ausdauertraining |
|
B (sollte) |
• Intensives supervidiertes Heimübungsprogramm (Kräftigung, Ausdauer, Balance) mit Progression • Progressives aerobes Laufbandtraining • Intensives Gehtraining unter Einschluss eines Laufbands |
|
0 (kann) |
• Aufgabenbezogenes Training mit Bewegungsvorstellung • Gehtraining mit Gehtrainer oder Lokomat, wenn Gerät vorhanden • Kraft-Ausdauertraining • zusätzliches Kraft-Ausdauertraining • Funktionelle Elektrische Mehrkanalstimulation während Gangtraining |
|
-B (sollte nicht) |
|
|
Chronische Phase |
|
|
A (soll) |
|
|
B (sollte) |
• Aufgabenbezogenes Ausdauertraining, z.B. progressives aerobes Laufbandtraining • Orthese mit Elektrostimulation (mittelbarer Effekt) |
|
0 (kann) |
• Intensives progressives aufgabenbezogenes Training • Kombination aus Laufbandtraining und variablem Gehtraining auf dem Boden • Gehtraining mit Gehtrainer, wenn Gerät vorhanden • Ergometertraining • Aufgabenbezogenes Krafttraining • Kraftfeedbacktraining • Bewegungsbeobachtung • Orthese mit Elektrostimulation (unmittelbarer Effekt) |
|
-B (sollte nicht) |
• Funktionelle Elektrostimulation mit perkutanen Drahtelektroden |
|
Subakute Phase |
|
|
A (soll) |
|
|
B (sollte) |
• Intensives Gehtraining ohne Laufband oder • Intensives Gehtraining unter Einschluss eines Laufbands oder • Intensives supervidiertes Heimübungsprogramm (Kräftigung, Ausdauer, Balance) mit Progression • Motor Relearning Programme |
|
0 (kann) |
• Gangtraining mit Gangtrainer oder Lokomat, Laufband, wenn vorhanden • zusätzliches Ergometertraining • Kraft-/Ausdauertraining • Rumpfaktivitäten auf instabiler Unterstützungsfläche • Zusätzliche Biofeedback-Plattform mit erweiterten Aufgabenstellungen • Akustisches Feedback beim Gehen • Nadelakupunktur inklusive Elektroakupunktur während intensiver Rehabilitation • Zusätzliche Elektroakupunktur • Frühzeitiger orthopädischer Schuh |
|
-B (sollte nicht) |
|
|
Chronische Phase |
|
|
A (soll) |
|
|
B (sollte) |
|
|
0 (kann) |
• Gangtraining mit Gangtrainer oder Lokomat, wenn vorhanden • Aufgabenbezogenes Krafttraining • Übungen auf instabiler Unterstützungsfläche • Übungsprogramm mit systematischer Verringerung der Unterstützungsfläche und Progression der Perturbation • Individualisiertes Übungsprogramm (Balance, Koordination) • Ai Chi (Tai Chi im Wasser) • Bewegungsbeobachtung • Zusätzliche Biofeedback-Plattform mit erweiterten Bewegungskomponenten • Zusätzliches VR-basiertes Training • Kombiniertes Dual-Task-basiertes Übungsprogramm |
|
-B (sollte nicht) |
• Funktionelle Elektrostimulation mit perkutanen Drahtelektroden |
Deutsche Gesellschaft für Neurorehabilitation e.V. (DGNR)

Deutscher Verband für Physiotherapie (ZVK) e.V.

Im Rahmen der S2e-Leitlinien-Arbeit bildeten in der Neurorehabilitation tätige Ärzte (Neurologen) und Therapeutinnen mit gesundheitswissenschaftlicher Expertise die engere Arbeitsgruppe. Diese Arbeitsgruppe bestand aus folgenden Personen (in alphabetischer Reihenfolge):
Patientenvertreter waren an der Erstellung der Leitlinie nicht beteiligt.
Die Website richtet sich an im Gesundheitswesen tätiges Fachpublikum. Die verfügbaren Informationen sind dazu bestimmt, die existierende Arzt- bzw. Therapeut-Patienten-Beziehung zu unterstützen, aber keinesfalls zu ersetzen.
Die Website wird nicht durch Werbung finanziert und akzeptiert keine Werbung.
Verantwortlich im Sinne des § 55 Abs. 2 RStV
Deutsche Gesellschaft für Neurorehabilitation e.V. (DGNR)
Geschäftsstelle der DGNR
c/o Angelica Totzauer
Hollerithstr. 14
53359 Rheinbach
Mobil: 0 163 - 87 15 023
Telefon: +49 (0) 22 26 - 80 96 59
E-Mail: info@dgnr.de
Internet: www.dgnr.de
vertreten durch die Vorsitzenden:
Prof. Dr. med. Thomas Mokrusch, Präsident der DGNR
Prof. Dr. med. Claus Wallesch, Vizepräsident der DGNR
Vereinsregister Amtsgericht: VR 8473
Die auf der Website veröffentlichten Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video- und Animationsdateien und deren Gestaltung sowie HTML, Java, Flash-Quellcodes u.a.) sind urheberrechtlich geschützt und zwar sowohl als individuelle Leistung wie als Sammlung. Jede Nutzung unterliegt den geltenden Urheberrechtsschutzgesetzen sowie anderer Schutzgesetze.
Die Inhalte sind nur für den bestimmungsgemäßen Abruf im Internet frei verfügbar. Inhalte dieser Website dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung des Betreibers nicht in irgendeiner Form vervielfältigt, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden.
Das Herunterladen und der Gebrauch von urheberrechtlich geschütztem Material ist den Benutzern ausschließlich zum Privatgebrauch erlaubt, soweit dies im Rahmen der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und dieser Nutzungsbedingungen geschieht.
Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird in keinem Fall übernommen.
Dies gilt neben dem Inhalt der Website auch für externe Links, es sei denn, etwaige rechtswidrige Inhalte und Links auf externe Internetseiten mit rechtswidrigen Inhalten sind uns bekannt und werden vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht unverzüglich entfernt. Insbesondere ist Voraussetzung für eine Haftung, dass eine Entfernung der rechtswidrigen Inhalte und Links technisch möglich und zumutbar ist.
Dieser Internetauftritt enthält Informationen für medizinisches Fachpublikum
Inhalte zum Thema Gesundheit ersetzen nicht den Rat oder die Behandlung eines Therapeuten, Arztes oder eines anderen Angehörigen der Heilberufe. Die Autoren und der Betreiber lehnen jede Verantwortung für Schäden oder Verletzungen ab, die direkt oder indirekt durch die Anwendung der in der Website dargestellten Übungen, Therapien und Behandlungsmethoden entstehen können. Es wird ausdrücklich bei Auftreten von Krankheitssymptomen und gesundheitlichen Beschwerden vor einer Selbstbehandlung auf der Grundlage der auf dieser Website dargestellten Inhalte ohne weitere ärztliche Konsultation gewarnt!
Online-Streitbeilegung
Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die Verbraucher für die Beilegung einer Streitigkeit nutzen können und auf der weitere Informationen zum Thema Streitschlichtung zu finden sind.
Außergerichtliche Streitbeilegung
Wir sind weder verpflichtet noch dazu bereit, im Falle einer Streitigkeit mit einem Verbraucher an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Konzeption, Gestaltung, Umsetzung und redaktionelle Betreuung
Jakob Tiebel, Ropachweg 14, 88400 Biberach, E-Mail: jakob.tiebel@outlook.de